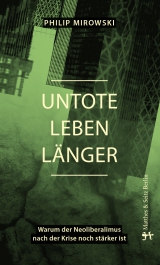»Seit den Kreditverträgen vom Mai 2010 zwischen Griechenland, der Europäischen Union und dem Internationalen Währungsfonds stehen alle zentralen Entscheidungen des griechischen Parlaments unter dem Vorbehalt der Gläubiger« – so der Klappentext zu Gregor Kritidis Buch »Griechenland – auf dem Weg in den Maßnahmenstaat«. Und man möchte ergänzen: Selbst die Wahl des Parlaments steht unter Vorbehalt. Zumindest wenn man den deutschen Pressekommentaren lauscht. Denn seit dem klar ist, dass im Januar Neuwahlen anstehen und die Linkspartei SYRIZA laut Umfragen die stärkste Kraft ist, dreht vor allem die deutsche Politikelite am Rad. Obwohl klar ist, dass es keine rechtlichen Möglichkeiten gibt, dass Griechenland die Eurozone verlässt, wird das Grexit-Szenario angerufen und somit deutlich gemacht: die EU und auch der Euro beruhen vor allem auf Machtverhältnissen, die Deutschland bestimmt und bestimmen will. In den kommenden Wochen wird sich deshalb auch zeigen, wie es EU- und Euro-Institutionen gelingt, sich gegen Deutschland durchzusetzen.
»Seit den Kreditverträgen vom Mai 2010 zwischen Griechenland, der Europäischen Union und dem Internationalen Währungsfonds stehen alle zentralen Entscheidungen des griechischen Parlaments unter dem Vorbehalt der Gläubiger« – so der Klappentext zu Gregor Kritidis Buch »Griechenland – auf dem Weg in den Maßnahmenstaat«. Und man möchte ergänzen: Selbst die Wahl des Parlaments steht unter Vorbehalt. Zumindest wenn man den deutschen Pressekommentaren lauscht. Denn seit dem klar ist, dass im Januar Neuwahlen anstehen und die Linkspartei SYRIZA laut Umfragen die stärkste Kraft ist, dreht vor allem die deutsche Politikelite am Rad. Obwohl klar ist, dass es keine rechtlichen Möglichkeiten gibt, dass Griechenland die Eurozone verlässt, wird das Grexit-Szenario angerufen und somit deutlich gemacht: die EU und auch der Euro beruhen vor allem auf Machtverhältnissen, die Deutschland bestimmt und bestimmen will. In den kommenden Wochen wird sich deshalb auch zeigen, wie es EU- und Euro-Institutionen gelingt, sich gegen Deutschland durchzusetzen.
Die gegenwärtige Debatte ist die Spitze eines Eisbergs, Ausdruck der autoritären Krisenpolitik der letzten Jahre, die Kritidis in seinem Buch in neun Abschnitten nachzeichnet. Griechenland, so die Frage im Titel, auf dem Weg in den Maßnahmenstaat? Den Begriff Maßnahmenstaat hat Kritidis von Ernst Fraenkel übernommen, der in seiner Analyse des Faschismus nachzeichnet, wie sich die Logik eines Maßnahmenstaats gegenüber dem Normenstaat zunehmend Bahnen bricht.
Wer wissen will, wie die »verordnete Schocktherapie« (Kritidis) Griechenland in eine soziale und politische Krise trieb, sollte das Buch zur Hand nehmen. Der Zerfall der demokratischen Institutionen, die Verelendung und der Aufstieg der extrem rechten Kräfte sind kein Zufall, sondern Ergebnis der Troika-Politik zugunsten der Gläubiger-Institutionen und -Staaten. Die gesammelten Beiträge verstehen sich als Aufklärung und Form von Gegenöffentlichkeit in einer Zeit, in der Unwissenheit und Ressentiments die Berichterstattung und Deutung der Eurokrise prägt. So kurz vor den Wahlen in Griechenland, sind dem Buch noch viele LeserInnen zu wünschen.
 In ihrem neuen Buch kritisiert Ulrike Herrmann den ökonomischen Mainstream – mit Smith, Marx und Keynes. Leider bleibt sie dabei auf halber Strecke hängen.
In ihrem neuen Buch kritisiert Ulrike Herrmann den ökonomischen Mainstream – mit Smith, Marx und Keynes. Leider bleibt sie dabei auf halber Strecke hängen.