Von Henrik Lebuhn und Ingo Stützle
Was die Gründung einer Oppositionspartei links der SPD angeht, hat die vorgezogene Neu-wahl in der parlamentarischen und in der außerparlamentarischen Linken eine Dynamik erzeugt, die noch im Juni dieses Jahres kaum jemand für möglich gehalten hätte. Binnen kürzester Zeit hat sich das Wahlbündnis zwischen PDS und WASG gegründet. Auch in der außerparlamentarischen Linken werden große Hoffnungen in das neue Parteiprojekt gesetzt. Öffentliche Diskussionsveranstaltungen zur Wahl stoßen selbst in der radikalen Linken auf breites Interesse. Wahlappelle werden formuliert, Allianzen geschmiedet und lebhaft über das Verhältnis zwischen außerparlamentarischer und parlamentarischer Linke debattiert. Das neue Projekt sorgt für Furore.
Ausgelassene Euphorie für das neue Linksdings ist also nicht nur bei der sozialen Basis der PDS und der WASG zu registrieren. Auch Teile der außerparlamentarischen und radikalen Linken, die schon lange keinen Sinn mehr in parteiförmiger Organisierung sehen, scheinen wieder Hoffnung in ein parlamentarisches Projekt zu setzen. Während die Entstehung der Linkspartei bei ersteren verständlicherweise begrüßt wird, bleibt die Zustimmung bei den letzteren eher befremdlich.
Parteien sind mächtige Realität
Es fragt sich: Entsteht hier tatsächlich eine “Partei neuen Typs”, die eine neue Dynamik in den Kampf gegen das neoliberale Einheitsdenken bringt? Worauf gründet sich die Hoffnung gerade der außerparlamentarischen Linken, dass sich die Linkspartei als erfolgreiches oppositionelles Parteiprojekt erweist und sich dabei auch noch positive Effekte für soziale Bewegungen ergeben? Kann aus einer antikapitalistischen und emanzipatorischen Perspektive davon ausgegangen werden, dass Parteipolitik im Parlament zukünftig dazu beitragen wird, die Verhältnisse grundlegend zu verändern? Völlig auszuschließen ist dies sicherlich nicht. Doch die Erfahrungen mit der PDS in den Landesregierungen und mit den Grünen seit 1998 auf Bundesebene geben allen Grund zur Skepsis. Und dabei hatten letztere in ihrer Gründungsphase zumindest noch den Wind einer starken sozialen Bewegung im Rücken. Die neue Linkspartei dagegen ist ein Projekt der Funktionäre.
Auch theoretische Überlegungen legen nahe, dass die jüngsten Anpassungsleistungen (ehemals) unbequemer Parteien an die parlamentarische Realität der Bundesrepublik mehr als nur historische Zufälligkeiten waren. Vielmehr muss die “materielle Dynamik organisatorischer Formen als dauerndes Problem” emanzipatorischer Politik unter bürgerlichen Verhältnissen begriffen werden. (1) Ein Grund für uns, bei der existenten Euphorie eine eher grundsätzliche Auseinandersetzung zu führen. Zwar wissen wir, dass auch vom Standpunkt einer staats- und kapitalismuskritischen Linken die Politik der Parteien als mächtige Realität akzeptiert werden muss. Das heißt jedoch nicht, den Parlamentarismus auch als Form der Politik, als Modus der gesellschaftlichen Konfliktaustragung und vor allem als Herrschaftsinstitution zu akzeptieren.
Staatszentrierheit vs. Bewegungsorientierung
Spätestens seit 1998 wird die systematische Entsicherung aller Lebens- und Arbeitsverhältnisse als gesamtparlamentarisches Projekt betrieben. Die Entstehung der Linkspartei ist vor allem Ausdruck eines in seiner Bedeutung wohl kaum zu unterschätzenden Bruchs zwischen SPD und Gewerkschaften. Zum ersten Mal in der Geschichte des DGB spricht dieser zur Bundestagswahl keine Wahlempfehlung aus. Mit ihrer unverfrorenen Politik zu Gunsten der Kapitalseite hat die SPD ihre eigene Basis mittlerweile zutiefst verunsichert. Und nicht nur die. Das Vertrauen in die Politik der großen Parteien scheint durchgängig erschüttert. Erstmals seit Gründung der Grünen im Jahr 1980 fühlen sich große Teile der Wähler und Wählerinnen mit ihren Interessen durch keine der etablierten Parteien mehr vertreten und suchen nach einer neuen Repräsentation im parlamentarischen System. Das neoliberale Einheitsprogramm der “virtuellen Gesamtpartei” (Agnoli) im Bundestag trägt Früchte.
Vor diesem Hintergrund kann die in den vergangenen eineinhalb Jahren zunächst in semi-klandestinen Zirkeln diskutierte und dann offensiv vorangetriebene Gründung einer Sozialstaatspartei also eigentlich gar nicht überraschen. Die neue Linkspartei könnte das Dilemma lösen, dass sich den von der Sozialdemokratischen Partei Enttäuschten schon seit geraumer Zeit keine wahlpolitische Alternative mehr bietet. Deutlich drückt sich die abgrundtiefe Verunsicherung vieler Wähler gegenüber allen parteipolitischen Alternativen in den Gründungsdiskussionen und -konzepten der Linkspartei aus.
Aber allein ein Vergleich der ersten Papiere zu einer Wahlalternative und der gegenwärtigen Ausrichtung der Linkspartei zeigt, dass Skepsis angesagt ist. So wurde im ersten Papier “Für eine wahlpolitische Alternative 2006” deutlich der Anspruch formuliert, “die intellektuellen und strukturellen Kapazitäten für Opposition zu stärken” und “nicht etwa ,regierungsfähig` zu werden”. Für viele Gruppen und Einzelpersonen aus dem außerparlamentarischen Spektrum knüpft sich unter anderem daran die Hoffnung, dass sich im Windschatten einer solchen Oppositionspartei auch wieder eine starke soziale Bewegung formieren, zumindest aber von einer Diskursverschiebung nach links profitieren könnte. Die Entstehung einer “Partei neuen Typs”, wie es sie in Italien mit der Rifondazione Comunista im Ansatz gibt, konnte man zumindest zeitweise für möglich halten. Auch wenn die Linkspartei sich dies nicht selbst auf die Fahne geschrieben hat.
Doch nach dem wahlkampftaktischen Zusammenschluss von WASG und PDS ist die neue Linkspartei von der Umsetzung des schwierigen Balanceaktes zwischen Stärkung außerparlamentarischer Gegenmacht und parlamentarischer Opposition, wie er in den frühen Strategiepapieren noch proklamiert wurde, leider meilenweit entfernt. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sitzt die PDS derzeit mit in den Landesregierungen und setzt vor allem in Berlin massive Sozialkürzungen rigoros durch. Eine systematische Kommunikation mit Aktivisten aus sozialen Bewegungen kommt in der PDS kaum zu Stande, obwohl in der Partei des demokratischen Sozialismus seit Jahren über mehr Bewegungsnähe diskutiert wird.
Staats- und Kapitalismuskritik – Fehlanzeige
Bisher waren es vor allem Einzelpersonen, die sich trotz ihrer Parteipolitik den sozialen Bewegungen verbunden fühlten. Wann immer sie damit parlamentarisch unbequem wurden, gab’s Schelte von oben: So etwa im Mai 2002 als der Fraktionschef der PDS, Roland Claus, sich bei George Bush für den Protest von Ulla Jelpke, Winfried Wolf und Heidi Lippmann entschuldigte, die im Bundestag ein Transparent gegen den Krieg in Afghanistan entrollt hatten. Ein Schlag ins Gesicht der Antikriegsbewegung. Auch die WASG bleibt bislang ein Projekt “von oben”. Von einer systematischen Einbeziehung sozialer Bewegungen ist auch hier nicht viel zu sehen.
Genau dies sind jedoch die neuralgischen Punkte, wenn es um die zukünftige Entwicklung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse in Deutschland geht. Werden außerparlamentarische Selbstorganisationsprozesse weiter angeregt? Wird sich die allgemeine Unzufriedenheit mit neoliberalen Regierungsprogrammen ausdehnen und radikalisieren? Oder werden die jüngsten Ansätze einer Basisbewegung von der neuen Linkspartei einfach “geschluckt”. Sowohl in der PDS als auch in der WASG stoßen in dieser Hinsicht unterschiedliche Politikvorstellungen und Selbstverständnisse aufeinander. Der Konflikt zwischen eher traditionalistischen Parteikonzepten und einer zumindest programmatisch verkündeten Nähe zu sozialen Bewegungen ist noch nicht entschieden. Aber mit den populistischen Zugpferden Lafontaine und Gysi bedarf es kaum noch einer sozialen Verankerung in sozialen Bewegungen. Ein Vorteil für die Traditionalisten. Zudem werden mit der zunehmenden Integration von PDS und WASG in die parlamentarische Verantwortung die Chancen eher abnehmen, dass sich mit der neuen Linkspartei auch ein starkes und radikales Bündnis linker Kräfte herausbildet, das mehr als nur parlamentarische Beatmungen bewirkt.
Was also, wenn die neue Linkspartei am Ende doch nur “die richtige Vertretung” sozialdemokratischer Wählerinteressen im Bundestag anstrebt? Was, wenn die zaghaften Ansätze eines gewerkschaftlichen Bruchs mit der Sozialdemokratie nicht in ein breites Bündnis mit sozialen Bewegungen münden, sondern sogleich in der Bindung an eine neue sozialdemokratische Kraft aufgefangen werden? Dann wäre damit auch der Staatszentrismus der deutschen Gewerkschaften aufs neue zementiert. So würde sich bestätigen, was Bodo Zeuner bereits vor dreißig Jahren an der deutschen Gewerkschaftsbewegung kritisierte: “Dass das Fortdauern der SPD-Bindung vor allem mit einer in der bürgerlichen Gesellschaft von Beginn an angelegten, in der deutschen Geschichte besonders ausgeprägten Staatsfixierung der Arbeiterklasse erklärt werden kann. Damit ist die (…) Überzeugung gemeint, dass das Handeln des Staates für die eigene Lebenslage als Arbeiter wesentlich entscheidender ist als alle Formen des eigenen organisierten Widerstands gegen das Kapital.” (2) Der so skizzierte Staatszentrismus zeigt sich auch immer dann, wenn soziale Bewegungen nur als einsetzbares Druckventil staatlicher Politik verstanden werden und ihre Organisationsmacht auf die Funktion verkürzt wird, staatliche Programme durchzusetzen.
Entscheidender als das Wahlprogramm der Linkspartei ist daher die Frage, ob sich die Gewerkschaften weiterhin in ihrer institutionellen Form als konstruktiver Bestandteil des “Modell Deutschland” verstehen oder sich im Sinne eines Social Movement Unionism als Teil sozialer Bewegungen sehen, und außerparlamentarischen Druck auf alle Parteien ausüben werden. Diese Diskussion wird in linksgewerkschaftlichen Kreisen bereits seit längerem geführt, und auch Horst Schmitthenner, Vorstandsmitglied der IG Metall, klagt bei der Linkspartei ein, dass außerparlamentarische Bewegungen “als notwendiger Teil eines erfolgreichen alternativen Projekts, als Gleiche unter Gleichen, nicht nur anerkannt, sondern auch herbeigesehnt, ja sogar befördert werden”. (Freitag, 2.9.05)
Mit der Gründung der Linkspartei könnte jedoch genau diesem Projekt der Wind (wieder) aus den Segeln genommen werden. Bietet sich doch nun wieder eine parlamentarische und innerinstitutionelle Alternative zur Bewegungsorientierung an. Gewerkschaftliche Forderungen und Strategiebestimmungen würden mit einer engen Ausrichtung an der Linkspartei wieder parlamentarisch vorformiert; ihre Politik an Parteidebatten und Gesetzesvorschlägen orientiert, anstatt mit anderen außerparlamentarischen Kräften eine Gegenmacht aufzubauen. Zurzeit sieht es tatsächlich so aus, als wenn die Linkspartei bei großen Teilen der Gewerkschaftsbasis auf distanzlose Zustimmung stößt. Mit ihrem Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine läuft die Linkspartei hier offene Türen ein, und vieler Orts stößt sie dabei auf eine gefährliche linksnationalistische Stimmung. Eigentlich nichts Neues für deutsche Verhältnisse. Bereits seit den 1980ern wird die Gewerkschaftskrise vor allem zu Gunsten der weißen, männlichen Kernbelegschaft verarbeitet. Auch wenn mit den ersten Versuchen einer gewerkschaftlichen Organisierung von Wanderarbeitern im Rahmen der IG BAU eine zaghafte Öffnung zu verzeichnen ist. (vgl. ak 486)
Überraschender ist da schon, dass auch große Teile der radikalen Linken sich aufgeschlossen bis distanzlos gegenüber dem parlamentarischen Linksprojekt zeigen. Dies wiederum scheint uns vor allem ein Indikator dafür zu sein, wie weit der öffentliche Diskurs mittlerweile nach rechts gerutscht ist und wie isoliert staats- und kapitalismuskritische Positionen trotz Münteferings Manager-Hetze hier zu Lande derzeit sind. Angesichts bundesdeutscher Bewegungsarmut versprechen sich viele von einer Orientierung an dem neuen parlamentarischen Akteur zumindest minimale politische Erfolge – wie trügerisch diese auch immer sein mögen.
Für die Annahme, dass mit Integration in den parlamentarischen Alltag die Umtriebigkeit eines neuen Linksprojekts abnimmt, gibt es nicht nur empirische Hinweise, sondern auch theoretische Argumente. Damit ist freilich eine Ebene der Kritik angesprochen, die nicht nur auf die Linkspartei zutrifft, sondern “zeitlos” und unabhängig von den spezifischen politischen Konstellationen an allen parlamentarischen Projekten formuliert werden kann. Parteien als “extrastaatliche Teilverwaltungen” (Narr) unterliegen in ihrer parlamentarischen Politik engen Restriktionen. Diese sind vor allem durch zwei Momente bestimmt: zum einen durch ganz grundlegende Merkmale von Staatlichkeit in kapitalistischen Gesellschaften und zum anderen durch die spezifische Funktionsweise parlamentarischer Demokratie. Beiden Momenten sind Parteien unterworfen – auch wenn sie sich in der Rolle der Opposition befinden und das Personal für die Regierung möglicherweise gar nicht stellen (wollen).
Bewegungsnähe trotz Parteipolitik
Das “Formprinzip der Konkurrenzpartei” (Offe) legt eine Logik nahe, nach der die Parteien Wählerstimmen suchen, wo immer sie zu bekommen sind. Mit zunehmender Integration ins parlamentarische System enthalten sie sich dabei immer mehr der Bezugnahme auf klassenmäßige, konfessionelle oder sonst wie spezialisierte Partikularinteressen. Statt dessen wird der “Bürger als abstraktes Willenssubjekt, als ein mit Stimmrecht ausgestatteter Jedermann angesprochen”. (3) Unter dem (Konkurrenz-)Druck, möglichst große Wählergruppen ansprechen zu müssen, werden spezifische Interessen und (Klassen-)Konflikte ausgeblendet und eine Politik für “die Mehrheit der Bevölkerung” formuliert.
Deutlich zeigt sich dieser staatstheoretische Befund auch im Falle der neuen Linkspartei bzw. in den programmatischen Statements ihrer frisch gebackenen Funktionäre. So äußerte sich etwa ein Mitinitiator der WASG in Berlin zur Niederlage des Wahlbündnisses Regenbogen bei den letzten Hamburger Bürgerschaftswahl wie folgt: “Meiner Meinung nach hat Regenbogen einen grundsätzlich falschen, einen typisch linken Milieuwahlkampf geführt. Sie haben die Probleme nicht zugespitzt, die die Hamburger bewegen. Wenn man solche Punkte aufgreift, dann hätten auch Wahlalternativen Erfolgsaussichten.” (Neues Deutschland, 3.3.04) Dass “die Hamburger” in zentralen politischen Fragen vielleicht gar keine gemeinsamen Probleme haben, die die Wahlalternative zuspitzen könnte, sondern vielmehr unvereinbare Interessengegensätze, welche es zu benennen gilt, scheint dem Mitbegründer der WASG gar nicht in den Sinn zu kommen.
Dieses Diktat, im Namen des Allgemeinwohls alles besser machen zu wollen, dem alle Parteien in der parlamentarisch-repräsentativen Demokratie unterliegen, hängt untrennbar mit den grundlegenden Bestimmungen von moderner, d.h. kapitalistischer Staatlichkeit zusammen. Als “ideeller Gesamtkapitalist” muss “der Staat” das kapitalistische Gesamtinteresse formulieren, um so die allgemeinen Produktionsbedingungen zu garantieren. Gerät die kapitalistische Akkumulation in die Krise, stehen die materiellen Reproduktionsbedingungen des “Steuerstaates” selbst auf dem Spiel. Stets bleibt er daher “Staat des Kapitals”, wie Johannes Agnoli es formulierte.
Formprinzip: Konkurrenzpartei
Freilich ist staatliche Politik nie durch die ökonomische Situation vollständig determiniert. Aus der allgemeinen Reproduktionserfordernis, die kapitalistische Verwertung aufrecht zu erhalten, lassen sich noch keine konkreten politischen Maßnahmen ableiten. Das kapitalistische Gesamtinteresse muss im politischen Prozess immer wieder neu ermittelt und der Konsens der Subalternen darüber organisiert werden. In diesem Zusammenhang verkörpert “das Parteiensystem (…) den Teil des regulativen Institutionenkomplexes, in dem antagonistische-plurale Interessen und Handlungsweisen in der Weise produziert, artikuliert, gerichtet, geformt, gefiltert und miteinander verbunden werden, dass ein relativ kohärentes, die gesamtgesellschaftliche Reproduktion gewährleistendes staatliches Handeln sowohl ermöglicht als auch legitimiert wird”. (4)
Das Feld staatlicher Politik ist also immer schon vorstrukturiert und nicht allein von Kräfteverhältnissen abhängig. Dabei lässt die Ermittlung des kapitalistischen Gesamtinteresses nicht nur Raum für konflikthafte Dynamiken, sondern bringt diese selbst hervor und macht ihre geregelte politische Bearbeitung möglich und nötig. Hier wird es auch für außerparlamentarische Akteure interessant. Denn natürlich können unterschiedlich politische Strategien der systemimmanenten Konfliktbearbeitung für die Betroffenen zu wesentlichen Verbesserungen ihrer Lebenslagen führen. Die Einführung von Hartz IV etwa unterlag natürlich keinem Sachzwang, sondern war den konkreten politischen Kräfteverhältnissen und Akteurskonstellationen geschuldet. In diese gilt es für eine außerparlamentarische Linke zu intervenieren. Zugleich müssen sich gerade Akteure, die sich mit fundamentalkritischen Positionen in die politische Arena begeben, der engen Grenzen staatlicher Politik bewusst sein. Für Hartz IV etwa gilt, dass die Ausweitung eines staatlich subventionierten Niedriglohnsektors und der Zwang zur (Lohn-)Arbeit gegen eine starke parlamentarische Linke vielleicht in dieser Form nicht durchzusetzen gewesen wäre. Zentral war in diesem Fall die Kooperation der Gewerkschaften. Doch globaler Standortwettbewerb, strukturelle Massenarbeitslosigkeit und leere Steuerkassen setzen auch einer Linkspartei enge sozialpolitische Handlungsspielräume, zumindest solange die Grundprinzipien kapitalistischer Vergesellschaftung nicht zur Disposition stehen. Sozialpolitik des bürgerlichen Staates bleibt eben immer die “Bearbeitung des Problems der Transformation von Nicht-Lohnarbeitern in Lohnarbeiter”. (5) Lohnarbeit als zentrale Vergesellschaftungsinstanz wird mit staatlicher Sozialpolitik nicht überwunden werden.
Dass der systemische Anpassungsdruck, den die Handlungsrationalität parlamentarischer Politik auf ihre Akteure ausübt, kaum zu unterschätzen ist, zeigt ein Blick auf die jüngste Vergangenheit bundesdeutscher Parteipolitik. Etwa auf die Grünen, die bis 1998 stets einen unversöhnlichen Pazifismus vertraten und nach den Bundestagswahlen – in “Regierungsverantwortung” wie es so schön heißt – den grundgesetzwidrigen Einsatz der Bundeswehr im Kosovo maßgeblich mittrugen.
Johannes Agnoli, der die Mechanismen der parlamentarischen Anpassung an realpolitische Erfordernisse bereits Ende der 1960er Jahre brillant beschrieben hat, meinte, dass eine emanzipative Politik im Parlament nur dann Aussicht auf Erfolg hätte, wenn die betreffende Partei eine konsequente Strategie der Fundamentalopposition verfolgt und dabei von einer starken sozialen Bewegung gegen den parlamentarischen Anpassungsdruck gestützt und gewissermaßen auf einer radikalen Linie gehalten wird. In einer solchen Situation bestimmt “der Kampf selbst, und nicht das konstituierte Regelsystem” die Politik. (6) Keine dieser Bedingungen ist heute erfüllt.
Doch der Parlamentarismus richtet seine Akteure nicht nur inhaltlich an den Erfordernissen der kapitalistisch-nationalstaatlichen Realität aus, sondern setzt auch seine eigenen Formen durch. Populismus, Konkurrenzverhalten, personalisierende und reduzierende Wahlkampfpolitik – all das bringt die Logik des Parlamentarismus selbst hervor; keine Partei, die dieses Verhalten nicht an den Tag legte. Ein linkes Projekt aber, das diesen Namen verdient, zeichnet sich durch das genaue Gegenteil aus: bedacht sollte es sein, aufklärerisch, strategisch und dabei doch kompromisslos.
Fallstricke des Parlamentarismus
Nun beabsichtigt die neue Linkspartei freilich gar nicht, kapitalismus- und staatskritische Positionen ins Parlament zu tragen. Doch auch wenn man die Linkspartei “nur” am eigenen Anspruch misst, bleibt Grund zur Skepsis. Worin besteht angesichts eines strikt sozialdemokratischen Programms eigentlich das kritische Potenzial der neuen Linkspartei? Selbst für den Fall, dass sich die Linkspartei “erfolgreich” durchsetzt, wird dies “bestenfalls” zur Aushandlung eines neuen Klassenkompromisses zwischen Kapital und Arbeit führen. Faule Kompromisse und Zugeständnisse wird es geben.
Sicherlich: Für die Betroffenen können parlamentarisch erkämpfte Freiräume und kleine Verbesserungen der Lebens- und Arbeitsverhältnisse einen wesentlichen Unterschied machen. Doch aus einer emanzipatorischen Perspektive muss es darüber hinaus immer auch darum gehen, ob und wie sich daraus weitergehende Proteste entwickeln und Gegenmacht aufgebaut wird. Es geht nicht nur um das Ausschöpfen von Handlungsspielräumen, sondern auch um die Frage, inwieweit damit bessere Rahmenbedingungen für weitergehende soziale Kämpfe geschaffen werden. Dass sich die Linkspartei dies zukünftig zur Aufgabe macht, ist aber alles andere als wahrscheinlich.
Zum einen, weil sie sich nach den Wahlen ihrer sozialen Basis erst einmal sicher sein kann. Zum anderen, weil eine kämpferische Klassenpolitik zu sperrig ist, um breite Wählerschichten anzusprechen. Eine Unterstützung der Linkspartei – entgegen aller Skepsis – muss deshalb ihren Maßstab darin finden, welche Relevanz die Verbesserung der Rahmenbedingungen für außerparlamentarische Politik für die Linkspartei selbst hat. Dies reicht von der politischen Ausrichtung der Rosa-Luxemburg-Stiftung über die öffentliche Distanzierung von widerständigen Praxen bis hin zur Rolle, die die Linkspartei in lokalen und regionalen Bündnissen spielen wird. Eine klare Ausrichtung auf mehrheitsfähige Politik wird außerparlamentarische linke Politik und Organisierung von Widerstand gegen die Verhältnisse erschweren.
Das Worst-Case-Szenario: Enttäuschte SPD-Wähler und Gewerkschafter, die noch im letzten Herbst erbost gegen Hartz IV auf die Straße gingen, werden ihre Interessen im Parlament vertreten und aufgehoben sehen. Die Notwendigkeit einer starken außerparlamentarischen Opposition wird vielen nicht mehr einsichtig sein und die eh schon schwachen Proteste gegen Arbeitszwang, Lohnsenkung und Sozialabbau endgültig erstickt. Am Ende könnte die außerparlamentarische Linke mit weniger dastehen als zuvor.
Wenn jetzt zu viele Hoffnungen auf die Linkspartei gesetzt werden, könnte dies, so unsere These, der außerparlamentarischen Linken – vom radikalen Flügel der Gewerkschaften über attac bis hin zu Antifa-Gruppen – möglicherweise mehr schaden als nützen. Um unsere beiden Kritiklinien noch einmal explizit zu machen:
1. Inhaltlich wird die Linkspartei im Bundestag bestenfalls sozialdemokratische und gewerkschaftliche Positionen vertreten, die der SPD abhanden gekommen sind. Von einem staats- und kapitalismuskritischen Projekt ist sie weit entfernt. Radikale Ecken und Kanten werden sich im parlamentarischen Prozess schnell abschleifen.
2. Aus Sicht einer grundlegenden Gesellschaftskritik bleibt die strategische Hoffnung, dass im Zuge der Neuformierung des parlamentarischen Feldes auch wieder eine starke soziale Bewegung entsteht. Doch weder löst die Linkspartei bislang ihren programmatischen Anspruch auf eine Zusammenarbeit und Stärkung sozialer Bewegungen ein, noch ist zurzeit eine außerparlamentarische Kraft in Sicht, die die Linkspartei auf einem oppositionellen Kurs halten könnte und so aus der neuen politischen Situation Kraft schöpfen könnte.
Statt Euphorie ist daher Skepsis angesagt. Wo es inhaltliche Gemeinsamkeiten gibt, ist gegen eine Zusammenarbeit zwischen parlamentarischer und außerparlamentarischer Linken wenig einzuwenden. Aktivisten aus sozialen Bewegungen und Anhänger der Linkspartei werden zukünftig – wie ja auch schon in der Vergangenheit – in vielen Bündnissen und Kampagnen am gleichen Strang ziehen. Nichts spricht dagegen und vieles dafür. Eine radikale Linke kann sich ihrer schwierigen Aufgabe nicht einfach so entledigen: Einfluss auf “Realpolitik” zu nehmen, und sich dabei weder institutionell inkorporieren zu lassen, noch in ein linkes Ghetto zurückzuziehen. Trotz globalisierungskritischer Bewegung und Hartz-IV-Protesten bleiben die Zeiten in Deutschland bewegungsarm. Gerade deswegen muss das außerparlamentarische Feld weiter bearbeitet werden, anstatt die Gründung einer Linkspartei abzufeiern.
Anmerkungen:
1) Wolf-Dieter Narr: Zum Politikum der Form – oder warum fast alle Emanzipationsbewegungen Herrschaft nur fortlaufend erneuern, allenfalls besänftigen, in: Leviathan, Heft 2/1980
2) Bodo Zeuner: “Solidarität” mit der SPD oder Solidarität der Klasse? Zur SPD-Bindung der DGB-Gewerkschaften, in: Prokla 26/1976
3) Claus Offe: Konkurrenzpartei und kollektive politische Identität, in: Roland Roth (Hg.): Parlamentarisches Ritual und politische Alternativen, Campus, Frankfurt am Main 1980
4) Jürgen Häusler/ Joachim Hirsch: Regulation und Parteien im Übergang zum “Postfordismus”, in: Das Argument 165/1987
5) zit. nach Stephan Lessenich: Vorwärts – und nichts vergessen. Die neue deutsche Sozialstaatsdebatte und die Dialektik sozialpolitischer Intervention, in: Prokla 116/1999
6) Johannes Agnoli: Wahlkampf und sozialer Konflikt, in: Transformation der Demokratie (Gesammelte Schriften, Bd.1), Freiburg/Br. 1990
Erschienen in: ak – analyse + kritik – Zeitung für linke Debatte und Praxis, Nr. 498 v. 16.09.2005, 33-34.
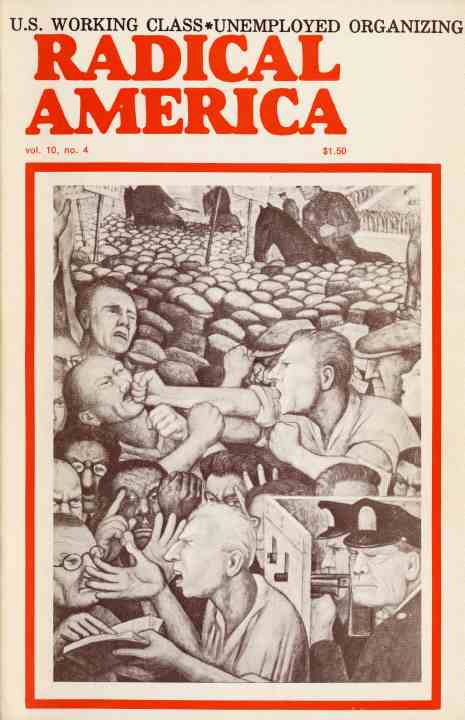 Bei Ernst Bloch gibt es die Formulierung der “Erinnerung an die Zukunft”. Ihm geht es dabei um eine Form von Geschichtsschreibung, die die Vergangenheit für die Zukunft und die Kämpfe in Erinnerung ruft. Nicht, um die Vergangenheit zu musealisieren, sondern um sie für die Emanzipation fruchtbar zu machen. Dies ist vor allem deshalb wichtig, weil die herrschende Historik nur selten die Erfahrungen der Kämpfe und die Niederlagen beachtet oder gar erwähnt.
Bei Ernst Bloch gibt es die Formulierung der “Erinnerung an die Zukunft”. Ihm geht es dabei um eine Form von Geschichtsschreibung, die die Vergangenheit für die Zukunft und die Kämpfe in Erinnerung ruft. Nicht, um die Vergangenheit zu musealisieren, sondern um sie für die Emanzipation fruchtbar zu machen. Dies ist vor allem deshalb wichtig, weil die herrschende Historik nur selten die Erfahrungen der Kämpfe und die Niederlagen beachtet oder gar erwähnt.
 Die Sehnsucht nach einem deutschen Obama, einem charismatischen Mann, der alles richtet, geht oft mit der Glorifizierung alter Staatsmänner einher. Angesichts der Finanzkrise und seines 90igsten Geburtstags wurde dann auch des Öfteren der gute alte Helmut Schmidt zum organischen Intellektuellen der staatstragenden Linken – da gaben sich die Linken innerhalb der SPD und der Lafontaine-Flügel in der Linkspartei nicht viel. Schließ prangerte er schon lange den Raubtierkapitalismus an. Das tolle an einer derartigen Projektionsfläche ist, dass die ersehnte politische Souveränität, Weitsichtigkeit sowie die Führungsfähigkeit, die über alle politischen und gesellschaftlichen Widersprüche erhaben scheint, die tatsächliche zu verantwortende Politik überstrahlt.
Die Sehnsucht nach einem deutschen Obama, einem charismatischen Mann, der alles richtet, geht oft mit der Glorifizierung alter Staatsmänner einher. Angesichts der Finanzkrise und seines 90igsten Geburtstags wurde dann auch des Öfteren der gute alte Helmut Schmidt zum organischen Intellektuellen der staatstragenden Linken – da gaben sich die Linken innerhalb der SPD und der Lafontaine-Flügel in der Linkspartei nicht viel. Schließ prangerte er schon lange den Raubtierkapitalismus an. Das tolle an einer derartigen Projektionsfläche ist, dass die ersehnte politische Souveränität, Weitsichtigkeit sowie die Führungsfähigkeit, die über alle politischen und gesellschaftlichen Widersprüche erhaben scheint, die tatsächliche zu verantwortende Politik überstrahlt. und Weise, in welcher über ökonomische Probleme gedacht wird, revolutionieren werde. Er sollte Recht behalten. Wahrscheinlich ist es zu voreilig, gegenwärtig von einer Krise der Neoklassik zu sprechen. Aber von einer Legitimationskrise des Neoliberalismus, in den zentrale Vorstellungen der Neoklassik eingeschrieben sind, ist allemal auszugehen.
und Weise, in welcher über ökonomische Probleme gedacht wird, revolutionieren werde. Er sollte Recht behalten. Wahrscheinlich ist es zu voreilig, gegenwärtig von einer Krise der Neoklassik zu sprechen. Aber von einer Legitimationskrise des Neoliberalismus, in den zentrale Vorstellungen der Neoklassik eingeschrieben sind, ist allemal auszugehen.
 30 Jahre nach dem Deutschen Herbst wundert man sich über gar nichts mehr. Die RAF ist im herrschenden Diskurs inzwischen eine Mischung aus museumsreifer Zeitgeschichte, soziologischem Phänomen mit dem Etikett “Terrorismus” und dem Bösen an sich. Die Würdigung des RAF-Anwalts Klaus Croissant und des politischen Kampfs in den 1960er und 1970er Jahren durch den Schriftsteller Peter O. Chotjewitz ist hierbei eine erfreuliche Ausnahme.
30 Jahre nach dem Deutschen Herbst wundert man sich über gar nichts mehr. Die RAF ist im herrschenden Diskurs inzwischen eine Mischung aus museumsreifer Zeitgeschichte, soziologischem Phänomen mit dem Etikett “Terrorismus” und dem Bösen an sich. Die Würdigung des RAF-Anwalts Klaus Croissant und des politischen Kampfs in den 1960er und 1970er Jahren durch den Schriftsteller Peter O. Chotjewitz ist hierbei eine erfreuliche Ausnahme.